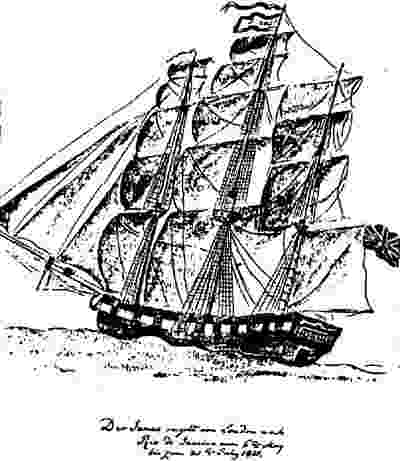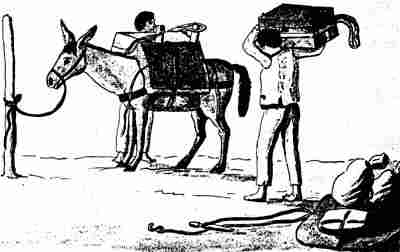Prinz Max zu Wied
Leben und Werk
Begleitschrift zur Ausstellung im Landschaftsmuseum Hachenburg 1994
Reise nach Brasilien 1815 bis 1817 Nachdem
Wied verschiedene Ziele, darunter vor allem Nordamerika, für
die seit langem angestrebte Überseereise in Erwägung gezogen
hatte, entschied er sich 1814 endgültig für Brasilien, wie
er seinem Freund Schinz am 14. September brieflich mitteilte. Mehrere
Gründe haben bei dieser Entscheidung mitgespielt. Brasilien,
das Wied hatte
sich durch Lektüre einschlägiger Werke gut vorbereitet.
Zitate im Reisebericht verraten ausgezeichnete Kenntnis der Literatur.
Er führte unter anderem Jean de Léry (1534-1613), Hans
Staden (1525/28 - ca. 1576), Charles Marie de la Condamine (1701-1774),
Felix d'Azara (1746-1821), Adam Johann von Krusenstern (1770-1846)
und Simao de Vasconcellos als Gewährsleute an. Der meistgenannte
Autor ist freilich Bei der Suche nach geeigneter Begleitung empfahl ihm der Berliner Zoologe Martin Lichtenstein (1780-1857) den Dichter und Naturforscher Baron Adelbert von Chamisso (Louis Charles Adelaide de Chamisso, 1781-1838), dem er aber absagen mußte, weil der Franzose die Kosten nicht aufbringen konnte. So griff der Prinz auf Bedienstete des Neuwieder Hofes zurück und engagierte den Jäger David Dreidoppel und den Gärtner Christian Simonis. Anfang Mai 1815 fuhren sie mit einem Rheinschiff nach Holland, von wo sie nach England übersetzten. Am 15. Mai gingen sie in London an Bord des Seglers "Janus", der nach 72 Tagen am 16. Juli im Hafen von Rio de Janeiro einlief.
Überwältigt von den ersten Eindrücken verlor Wied dennoch nicht den eigentlichen Zweck der Reise aus den Augen und suchte sofort Kontakte mit namhaften Intellektuellen und Reisenden, die sich auf der Facenda "Mandioca" an der Sierra da Estrela des russischen Generalkonsuls Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852) zu treffen pflegten. Hier legte der "Baron von Braunsberg", wie Maximilian sich in Übersee nannte, endgültig seine Reiseroute fest. Die Capitania Minas Gerais schied weitgehend aus, da diese Gegend durch Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855) und den Engländer John Mawe (1764-1829) seit etwa 1810 wissenschaftlich bearbeitet wurde. Dagegen war Wied auf Besuche des deutschen Mineralogen Wilhelm Christian Gotthelf von Feldner (1772-1822) in die küstennahen Gebiete zwischen Rio de Janeiro und Salvador aufmerksam gemacht worden, wo dieser in unbekannten Gegenden unberührte Natur und freie Indianervölker angetroffen hatte. Glückliche Umstände führten Wied mit dem Ornithologen Georg Wilhelm Freyreiss (1781-1825) und dem Botaniker Friedrich Sellow (1789-1831) zusammen, die mit bzw. wie Freyreiss durch Langsdorff (1813) nach Brasilien gekommen waren. Sie waren gerne bereit, Wied zu begleiten und ihm nicht zuletzt durch ihre Sprachkenntnisse hilfreich zu sein. Die großzügige Unterstützung durch den brasilianischen Minister Silverio Jose Manoel de Araujo, Conde de Barca, ermöglichte am 4. August den Aufbruch von Sao Christovao nach Cabo Frio und weiter nach Villa de San Salvador dos Campos dos Goayatacases, dem jetzigen Campos, und zum Rio Paraiba, wo bei Sao Fidélis die erste Begegnung mit freien Indianervölkern - den Puri, Coroado und Patachó - erfolgte. "Francisco", ein noch in Rio de Janeiro engagierter Coropó, war als Dolmetscher tätig. Die Flüsse Itabapuana und Itapemirim wurden Anfang November überquert.
Über Vila Nova de Benevente erreichte die "tropa" (Lasttierkarawane) am 17. November Goaraparim (Guarapari) und zwei Tage später Villa Velha do Espiritu Santo und die Cidade de Victoria, also Vila Velha und die heutige Landeshauptstadt Vitória, wo man die erste Post aus Europa empfing. Man verweilte während der Regenzeit südlich außerhalb der Stadt in Barra de Jucú an der Mündung des gleichnamigen Flusses. Am 19.
Dezember brachen Wied und Freyreiss vorzeitig auf und erreichten nach
Durchqueren der Mangue-Sümpfe über Quartel do Riacho (=
Riacho) Am 30.
Dezember ging es weiter über Barra de Sao Mateus (= Con ceicao
de Barra) bei der Mündung des gleichnamigen Flusses und weiter
nach Villa de S. José do Port' Allegre, Bei der
Weiterreise nordwärts wurde Aufenthalt Von Villa de Belmonte folgte Wied dem Rio Jequitinonha flußaufwärts bis Quartel dos Arcos in das Gebiet der Botokuden. Bleibende Frucht dieses wichtigen Reiseabschnittes ist die Monographie einer längst untergegangenen Welt. Erneut kam es auch zu Begegnungen mit den Patixó. Am 28.
September kehrte Wied nach Belmonte zurück. Er reiste noch einmal
nach Caravelas und Mucuri, wo er Sellow und Freyreiss wiedertraf und
mit ihnen drei Wochen verlebte. Am Über
Canavieiras und Una, wo die lange Ilha Comandatuba der Küste
vorgelagert ist, führte der Weg weiter über Olivenca nach
Ilhéus. Von hier wandte sich die Reisegruppe landeinwärts
nach Sao Pedro d 'Alcantara und weiter vier anstrengende Wochen durch
dichte Urwälder, bis am 31. Januar 1817 Barra da Vareda im Sertao
erreicht war. Diese von Wied Nun ging es zurück und in nordöstlicher Richtung nach Arrayal da Conquista (= Vitória da Conquista), wo es noch einmal zu Begegnungen mit den Camacán kam. Der Rio das Contas und der Rio Jiquiricá waren überquert, als Soldaten die Expedition gefangennahmen und nach Nazaré brachten. Man verdächtigte sie, englische Spione zu sein und gleiche Sache mit den Aufständischen in Salvador (Bahia) zu machen. Darüber und wegen des unnötigen Aufenthaltes war Maximilian sehr aufgebracht. Nach Aufklärung des Irrtums setzte man die Reise über Jaguaripe fort, setzte zur Insel Itapirica und von dort nach Salvador (Bahia) über, dem Ziel der Reise, mehr als 1000 km nördlich von Rio de Janeiro. Im Mai 1817 schiffte sich Wied mit Dreidoppel und Simonis auf der "Princesa Carlota" nach Europa ein. Über Lissabon und London kamen die Reisenden im August in Neuwied an.
|